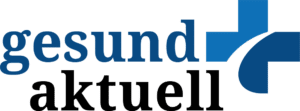Das prämenstruelle Syndrom betrifft bis zu 90% aller prämenopausalen Frauen im gebärfähigen Alter. Während viele Menschen PMS lediglich mit Stimmungsschwankungen in Verbindung bringen, umfasst die Realität ein weitaus breiteres Spektrum an Beschwerden. Tatsächlich leiden je nach Erhebung 20 bis 40 Prozent aller Frauen deutlich stärker unter den prämenstruellen Beschwerden und kämpfen oft mit mehreren Symptomen gleichzeitig.
Die Bandbreite der körperlichen Symptome reicht von Kopfschmerzen und Schlafstörungen über Spannungsgefühle in der Brust bis hin zu Kreislaufproblemen und unreiner Haut. Darüber hinaus gehören zu den psychischen Symptomen nicht nur die bekannten Stimmungsschwankungen, sondern auch Konzentrationsschwäche, Lethargie und Erschöpfung. Besonders schwerwiegend ist die prämenstruelle dysphorische Störung (PMDS), unter der etwa drei bis acht Prozent der Frauen im reproduktiven Alter leiden. Diese Erkrankung kann den Alltag der Betroffenen erheblich beeinträchtigen. Allein in der Schweiz gibt es mindestens 360.000 Frauen zwischen 15 und 50 Jahren, die unter dem prämenstruellen Syndrom leiden.
Was ist das prämenstruelle Syndrom (PMS)?
Wenn die Tage vor den Tagen zur Qual werden: Als prämenstruelles Syndrom bezeichnet man eine wiederkehrende Störung, die mit verschiedenen körperlichen und psychischen Symptomen einhergeht. Diese Symptome treten typischerweise in der zweiten Zyklushälfte auf und verschwinden mit oder kurz nach Beginn der Menstruation wieder. Der Begriff „prämenstruell“ bedeutet dabei schlicht „vor der Menstruation auftretend“.
Definition und Abgrenzung zu normalen Zyklusbeschwerden
Das prämenstruelle Syndrom umfasst eine Palette von mehr als 150 verschiedenen Symptomen, die unterschiedlich oft und intensiv auftreten können. Diese Beschwerden beginnen in der Regel etwa vier bis 14 Tage vor dem Einsetzen der Periode. Im Gegensatz zu normalen Zyklusbeschwerden, die viele Frauen leicht spüren, sind die Symptome beim PMS deutlich ausgeprägter und beeinträchtigen den Alltag merklich.
Während leichte Veränderungen im Körper vor der Menstruation normal sind, zeichnet sich das prämenstruelle Syndrom durch die Kombination mehrerer Symptome aus, die sich zunehmend verschlimmern und dann am ersten oder zweiten Tag der Blutung wieder verschwinden. Diese zyklische Natur der Beschwerden ist ein charakteristisches Merkmal des PMS und grenzt es von anderen Erkrankungen ab.
Wie häufig ist PMS?
Die Häufigkeit des prämenstruellen Syndroms variiert je nach Studie und Definition. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen allerdings, dass etwa 20 bis 50 Prozent aller Frauenim gebärfähigen Alter unter dem prämenstruellen Syndrom leiden. Dabei erleben rund 30 von 100 Personen mit Periode stärkere Symptome, die sie im Alltag, im Beruf und im Familienleben beeinträchtigen können.Bemerkenswert ist außerdem, dass PMS nicht nur Frauen betrifft. Jeder Mensch mit Menstruationszyklus kann PMS-Beschwerden entwickeln – darunter auch Trans-Männer, die mit einer Gebärmutter und Eierstöcken geboren wurden. Das Syndrom kann in jedem Alter zwischen der ersten Regelblutung und den Wechseljahren auftreten, wobei es bevorzugt bei Personen über 30 Jahren vorkommt. Nach den Wechseljahren treten keine PMS-Beschwerden mehr auf.
Unterschied zwischen PMS und PMDS
Die prämenstruelle dysphorische Störung (PMDS) stellt die schwerste Form des prämenstruellen Syndroms dar. Während bei PMS oft körperliche Symptome im Vordergrund stehen können, dominieren bei der PMDS die psychischen Beschwerden. Etwa zwei bis acht Prozent der Menschen mit Periode erleben diese ausgeprägten psychischen Symptome.
Die PMDS zeichnet sich durch mindestens eines der folgenden Hauptsymptome aus:
- Labile Stimmung und starke Stimmungsschwankungen
- Ausgeprägte Gereiztheit und plötzliche Wutausbrüche
- Depressive Verstimmungen bis hin zu Hoffnungslosigkeit
- Ausgeprägte Ängste und innere Anspannung
Im Gegensatz zum PMS ist die Symptomatik bei der PMDS so stark, dass der Tagesablauf erheblich beeinträchtigt wird. Freundschaften, das Familienleben und der Beruf können in der Folge deutlich leiden. Seit 2022 ist die PMDS offiziell als eigenständige Erkrankung im Diagnosehandbuch ICD-11 der Weltgesundheitsorganisation anerkannt. Davor wurde sie oft nicht oder erst spät erkannt, da sie kaum erforscht war und nicht zum regulären Lehrinhalt im Medizinstudium oder in der gynäkologischen Ausbildung gehörte.
PMS Symptome: Mehr als nur Stimmungsschwankungen
Die Vielfalt und Komplexität der PMS-Symptome werden häufig unterschätzt. Die zahlreichen körperlichen und psychischen Beschwerden können das Leben einer Frau vorübergehend erheblich beeinträchtigen und treten typischerweise wenige Stunden bis zu fünf Tage vor der Menstruation auf. Dabei verschwinden sie oft vollständig einige Stunden nach Beginn der Periode.
Körperliche Symptome im Überblick
Die körperlichen Manifestationen des prämenstruellen Syndroms sind außerordentlich vielfältig. Zu den häufigsten zählen Kopf- und Rückenschmerzen, ein Spannungsgefühl in den Brüsten sowie Wassereinlagerungen. Viele Frauen berichten darüber hinaus über Bauchschmerzen, Blähungen, Verstopfung und ein allgemeines Völlegefühl. Insbesondere bei den Symptomen der Rücken- und Bauchschmerzen, sowie der Verstopfung, Durchfall und Blähungen darf die PMS nicht mit einer Endometriose verwechselt werden, bei welcher die eben genannten Symptome ebenfalls auftreten können. Die Endometriose bleibt ebenfalls wie PMS häufig jahrelang undiagnostiziert.Besonders charakteristisch ist die Neigung zur Ödembildung, die zu sichtbaren Wasseransammlungen im Gesicht, an den Augenlidern, Händen und Füßen führen kann – betroffene Frauen fühlen sich dadurch oft regelrecht aufgedunsen. Darüber hinaus können Hautprobleme wie Akne, Gelenkschmerzen, Schlafstörungen und Verdauungsprobleme auftreten. Einige Betroffene leiden zusätzlich unter Heißhungerattacken, besonders auf süße oder salzige Speisen.
Psychische Symptome und ihre Auswirkungen
Die emotionalen und kognitiven Veränderungen durch PMS können ebenso belastend sein wie die körperlichen Beschwerden. Zu den typischen psychischen Symptomen gehören Reizbarkeit, Angstzustände, Stimmungsschwankungen und depressive Verstimmungen. Besonders ausgeprägt können auch Konzentrationsschwierigkeiten, Lethargie, Schlaflosigkeit und eine starke Müdigkeit sein.Diese psychischen Beeinträchtigungen wirken sich direkt auf den Alltag aus. Je nach Erhebung spüren 20 bis 40 Prozent aller Frauen die prämenstruellen Beschwerden deutlich stärker und leiden oft unter mehreren Symptomen gleichzeitig. Die Folge: Diese Frauen müssen sich in Beruf, Freizeit und Familienleben einschränken und können nicht wie gewohnt durch den Tag gehen.
Symptome bei PMDS
Die prämenstruelle dysphorische Störung stellt eine besonders schwere Form des PMS dar und betrifft etwa drei bis acht Prozent der Frauen im reproduktiven Alter. Bei dieser Erkrankung stehen die psychischen Beeinträchtigungen deutlich im Vordergrund.
Typisch für die PMDS ist eine gravierende psychische Veränderung bis hin zur Wesensveränderung. Betroffene werden stark reizbar, aggressiv, ängstlich, niedergeschlagen und hoffnungslos. Folgende Hauptsymptome sind für die Diagnose einer PMDS entscheidend:
- Depressive Verstimmung, Hoffnungslosigkeit, selbstherabsetzende Gedanken
- Ängstlichkeit und starke innere Anspannung
- Deutliche Stimmungsschwankungen mit plötzlicher Traurigkeit
- Anhaltende Reizbarkeit oder Wut mit vermehrten zwischenmenschlichen Konflikten
Die Belastung ist bei PMDS teilweise so groß, dass Betroffene deutliche Auswirkungen auf ihre alltäglichen Aufgaben oder beruflichen Verpflichtungen wahrnehmen und diesen nur eingeschränkt oder gar nicht mehr nachkommen können. Studien zeigen, dass Menschen mit PMDS häufiger Suizidgedanken haben und Suizidversuche unternehmen als andere Personen.
PMS oder Schwangerschaft?
Die Unterscheidung zwischen PMS und frühen Schwangerschaftsanzeichen kann schwierig sein, da viele Symptome sich überschneiden. Sowohl bei PMS als auch in der Frühschwangerschaft können Übelkeit, Brustspannen, Stimmungsschwankungen, Müdigkeit und häufiger Harndrang auftreten.
Allerdings gibt es einige unterscheidende Merkmale: Bei PMS treten die Symptome regelmäßig in der zweiten Zyklushälfte auf und verschwinden mit Beginn der Menstruation. Bei einer Schwangerschaft hingegen bleibt die Periode aus und die Basaltemperatur bleibt dauerhaft erhöht. Zudem ist Übelkeit mit Erbrechen häufiger ein Zeichen der Frühschwangerschaft, während beim PMS zwar leichte Übelkeit vorkommen kann, diese aber meist nicht sehr ausgeprägt ist. Ein weiterer Unterschied: In der Schwangerschaft können dunklere Brustwarzen auftreten – ein Symptom, das für PMS untypisch ist.
Ursachen und Risikofaktoren von PMS
Die Forschung arbeitet noch immer daran, die genauen Ursachen des prämenstruellen Syndroms vollständig zu entschlüsseln. Trotz jahrzehntelanger Untersuchungen gibt es bislang keine abschließende Erklärung, warum manche Frauen unter PMS leiden und andere nicht. Fachleute vermuten allerdings eine Kombination verschiedener Faktoren, die zusammenwirken.
Hormonelle Schwankungen im Zyklus
Obwohl bei Frauen mit PMS nicht immer ein veränderter Hormonspiegel nachweisbar ist, reagieren viele Betroffene empfindlicher auf die natürlichen Hormonschwankungen nach dem Eisprung. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Hormon Progesteron, das in der zweiten Zyklushälfte vermehrt gebildet wird, während gleichzeitig die Östrogenproduktion abnimmt. Besonders die Abbauprodukte des Progesterons können bei manchen Frauen PMS-Symptome auslösen.
Darüber hinaus kommt es in der zweiten Zyklushälfte zu einem natürlichen Anstieg des Hormons Prolaktin, das ein Anschwellen der Brustdrüsen anregen und dadurch unangenehme Schmerzen verursachen kann. Die hormonellen Veränderungen beeinflussen außerdem den Flüssigkeitshaushalt des Körpers, was die typischen Wassereinlagerungen erklärt.
Serotonin und andere Botenstoffe
Ein wichtiger Zusammenhang besteht zwischen den zyklischen Hormonschwankungen und dem Gehirnbotenstoff Serotonin. Dieser Neurotransmitter, auch als „Glückshormon“ bekannt, steht in direkter Verbindung mit unserem Wohlbefinden. Studien zeigen, dass die Serumserotoninkonzentration bei Patientinnen mit PMS in der Lutealphase geringer ist als bei gesunden Frauen. Zudem wurde nachgewiesen, dass der Serotonin-Transporter vor der Menstruation erhöht ist, was zu einer Abnahme dieses Botenstoffs im Gehirn führt.
Diese Erkenntnis erklärt, warum selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) zu den effektivsten Behandlungsoptionen bei PMS und PMDS zählen. Auch die Nahrungsergänzung mit Tryptophan, einer Vorstufe des Serotonins, kann die PMS-Symptome lindern.
Genetische Veranlagung
Die familiäre Veranlagung spielt ebenfalls eine wesentliche Rolle bei der Entstehung von PMS. Hat eine weibliche Verwandte solche Beschwerden, ist das Risiko für die unangenehmen Veränderungen vor der Regelblutung höher. Wissenschaftliche Untersuchungen diskutieren genetische Polymorphismen im ESR1-Gen, das für den Östrogenrezeptor-α kodiert.
Bei der prämenstruellen dysphorischen Störung (PMDS) wurde inzwischen eine genetisch bedingte Überempfindlichkeit auf Sexualhormone nachgewiesen. Menschen mit einer solchen Veranlagung reagieren besonders stark auf die normalen hormonellen Veränderungen im Zyklus.
Einfluss von Stress, Ernährung und Umweltfaktoren
Verschiedene Umwelt- und Lebensstilfaktoren können PMS-Symptome verstärken oder abschwächen. Studien zeigen, dass Frauen mit hoher Stressbelastung ein fast fünfmal höheres Risiko haben, unter PMS zu leiden. Außerdem können Rauchen, Alkohol und psychische Belastungen die Beschwerden intensivieren. Tatsächlich entwickeln Frauen, die rauchen, doppelt so häufig PMS.
Auch die Ernährung beeinflusst die Symptome: Zu viel Zucker, Kaffee, Salz und Alkohol können PMS-Beschwerden verstärken. Kaffee fördert zudem die Produktion von Prostaglandinen, hormonähnlichen Substanzen, die viele PMS-Symptome auslösen können. Zusätzlich entzieht Koffein dem Körper wichtige Nährstoffe wie Magnesium, die für ein hormonelles Gleichgewicht bedeutsam sind.Übergewicht oder Untergewicht gelten ebenfalls als Risikofaktoren für PMS. Der Körper reagiert auf diese komplexen Wechselwirkungen mit dem breiten Spektrum an Symptomen, die für das prämenstruelle Syndrom charakteristisch sind.
Diagnose PMS und Abgrenzung zu anderen Erkrankungen
Die korrekte Diagnose des prämenstruellen Syndroms erfordert sorgfältige Beobachtung und präzise Dokumentation. Viele der typischen PMS-Symptome überschneiden sich mit anderen Erkrankungen, was die eindeutige Zuordnung erschwert.
Wann spricht man von PMS?
Von einem prämenstruellen Syndrom wird gesprochen, wenn Symptome in der zweiten Zyklushälfte auftreten und mit Einsetzen der Periode nachlassen oder gänzlich verschwinden. Entscheidend ist der zyklische Charakter der Beschwerden. Das American College of Obstetricians and Gynecologists definiert PMS bereits dann, wenn ein einziges Symptom auftritt, das die soziale oder berufliche Funktion relevant beeinträchtigt.
Für die Diagnose einer prämenstruellen dysphorischen Störung (PMDS) müssen strengere Kriterien erfüllt sein. Nach den DSM-5-Kriterien müssen für den Großteil des vergangenen Jahres verhaltens- und körperbezogene Symptome bestanden haben und in der Woche vor Menstruationsbeginn fünf oder mehr Symptome auftreten, die innerhalb weniger Tage nach Menstruationsbeginn vollständig abklingen. Diese Symptome müssen außerdem ausreichend stark sein, dass Alltagsaktivitäten und Allgemeinzustand beeinträchtigt werden.
Rolle des Symptomtagebuchs
Das Symptomtagebuch ist das wichtigste diagnostische Instrument bei Verdacht auf PMS. Da es bislang keinen Test gibt, mit dem sich PMS oder PMDS nachweisen lässt, und die Hormonwerte bei Betroffenen oft völlig normal sind, hilft nur die prospektive Erfassung der Symptome über mindestens zwei bis drei Zyklen.
Das Tagebuch sollte Folgendes dokumentieren:
- Zeitpunkt des Symptombeginns und -endes
- Art und Schweregrad der Beschwerden
- Auswirkungen auf die Alltagsfunktion
Diese Dokumentation ermöglicht es, den zyklischen Charakter der Beschwerden zu erkennen und das typische Muster zu identifizieren: Symptome in der Lutealphase und Symptomfreiheit in der Follikelphase. Ärzte können anhand dieses Musters beurteilen, ob es sich tatsächlich um PMS handelt oder ob andere Erkrankungen in Betracht gezogen werden müssen.
Differenzialdiagnose: Depression, Schilddrüse, Endometriose
Die Unterscheidung zwischen PMS und Depression ist oft schwierig, da die Symptome sich überschneiden können. Während PMS-Symptome zyklisch auftreten und mit der Menstruation verschwinden, bestehen depressive Symptome kontinuierlich, unabhängig vom Zyklus. Bei unsicherer Diagnose kann das Symptomtagebuch Aufschluss geben.
Schilddrüsenerkrankungen können ebenfalls PMS-ähnliche Beschwerden hervorrufen. Insbesondere Frauen mit Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion berichten über Symptome, die sich in der zweiten Zyklushälfte verschlimmern. Eine sorgfältige Diagnostik sollte daher endokrinologische Erkrankungen wie Hyper- und Hypothyreose ausschließen.Auch die Endometriose verursacht Beschwerden, die mit PMS verwechselt werden können. Bei dieser Erkrankung wächst Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutterhöhle. Allerdings sind die Schmerzen bei Endometriose häufig nicht streng zyklusgebunden und können auch außerhalb der prämenstruellen Phase auftreten. Eine eindeutige Diagnose der Endometriose erfordert meist eine Laparoskopie (Bauchspiegelung).
Behandlungsmöglichkeiten bei PMS und PMDS
Die Behandlung von PMS und PMDS basiert auf einem abgestuften Ansatz – von einfachen Selbsthilfemaßnahmen bis hin zu medikamentösen Therapien bei schweren Fällen.
Lebensstiländerungen und Selbsthilfe
Bei leichten bis mittelschweren Symptomen können bereits Änderungen im Lebensstil erhebliche Verbesserungen bewirken. Besonders wirksam ist regelmäßige körperliche Aktivität. Fachgesellschaften empfehlen 150-300 Minuten moderate Bewegung oder 75-150 Minuten intensive Aktivitäten pro Woche. Auch Stressabbau spielt eine wesentliche Rolle – Frauen mit hoher Stressbelastung haben ein fast fünfmal höheres PMS-Risiko.
Entspannungsverfahren wie Yoga, Meditation oder progressive Muskelentspannung können prämenstruelle Beschwerden deutlich lindern. Außerdem zeigen Studien, dass ausreichend Schlaf und der Verzicht auf Rauchen, Alkohol und übermäßigen Koffeinkonsum die Symptome abschwächen können.
Pflanzliche Mittel und Nahrungsergänzung
Viele Betroffene setzen auf natürliche Alternativen wie Mönchspfeffer. Dieser soll angeblich den Zyklus harmonisieren und PMS-Beschwerden reduzieren. Die Wirksamkeit ist allerdings umstritten.
Medikamente: Schmerzmittel, SSRI, Hormonpräparate
Bei stärkeren Beschwerden oder ausgeprägter PMDS kommen Medikamente zum Einsatz. Schmerzmittel aus der Gruppe der nicht-steroidalen Antirheumatika helfen effektiv gegen Menstruationsschmerzen.
Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) gelten als Mittel der ersten Wahl bei PMDS. Etwa 60–70% aller PMS-Patientinnen profitieren von einer SSRI-Behandlung. Wirkstoffe wie Fluoxetin, Sertralin und Paroxetin haben sich besonders bewährt und können kontinuierlich oder nur in der Lutealphase eingenommen werden.
Hormonelle Verhütungsmittel, besonders monophasige Präparate mit Drospirenon, können ebenfalls wirksam sein. Bei sehr schweren Fällen kommt manchmal eine Behandlung mit GnRH-Agonisten in Betracht.
Wann eine ärztliche Behandlung notwendig ist
Ein Arztbesuch ist ratsam, wenn PMS-Symptome den Alltag erheblich beeinträchtigen. Besonders wichtig ist professionelle Hilfe bei Verdacht auf PMDS mit starken psychischen Beschwerden wie Depressionen oder Suizidgedanken – immerhin erleben 70% der PMDS-Betroffenen solche Gedanken.Außerdem sollte ärztliche Hilfe bei folgenden Anzeichen aufgesucht werden: starke Blutungen außerhalb der Periode, anhaltende Schmerzen im Unterleib und zyklusunabhängige Brustveränderungen. Diese können auf andere Erkrankungen hindeuten, die ähnliche Symptome wie PMS verursachen.
Fazit
Das prämenstruelle Syndrom stellt zweifellos mehr als nur Stimmungsschwankungen dar. Die zahlreichen körperlichen und psychischen Symptome beeinträchtigen den Alltag vieler Frauen erheblich. Besonders bemerkenswert ist die Vielfalt der Beschwerden – von Kopfschmerzen und Wassereinlagerungen bis hin zu Konzentrationsschwierigkeiten und depressiven Verstimmungen.
Der zyklische Charakter dieser Beschwerden unterscheidet PMS deutlich von anderen Erkrankungen. Tatsächlich verschwinden die Symptome meist kurz nach Einsetzen der Menstruation, was die Diagnosestellung durch sorgfältige Dokumentation in einem Symptomtagebuch erleichtert.
Die Ursachen für PMS sind vielschichtig. Hormonelle Schwankungen, genetische Veranlagung sowie Umwelt- und Lebensstilfaktoren spielen zusammen eine entscheidende Rolle. Gerade diese Komplexität macht einen individuellen Behandlungsansatz notwendig.
Frauen müssen jedoch nicht hilflos leiden. Abhängig vom Schweregrad der Symptome stehen verschiedene Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Lebensstiländerungen, pflanzliche Präparate wie Mönchspfeffer oder Nahrungsergänzungsmittel können bei leichteren Beschwerden bereits Linderung verschaffen. Bei schwereren Fällen, insbesondere bei PMDS, helfen zusätzlich medikamentöse Therapien.Gesellschaftlich betrachtet verdient das prämenstruelle Syndrom mehr Aufmerksamkeit und Verständnis. Die Enttabuisierung dieses Themas ermöglicht betroffenen Frauen, offen über ihre Beschwerden zu sprechen und rechtzeitig Hilfe zu suchen. Dadurch können sie letztendlich ihre Lebensqualität während der prämenstruellen Phase deutlich verbessern.
FAQs
Q1. Warum kommt es bei PMS zu Stimmungsschwankungen?
Bei PMS beeinflussen hormonelle Veränderungen den Serotoninspiegel im Gehirn. Ein niedriger Serotoninspiegel kann zu Müdigkeit, Reizbarkeit oder Niedergeschlagenheit führen. Besonders der sinkende Östrogenspiegel vor der Periode ist für die plötzlichen Stimmungswechsel verantwortlich.
Q2. Welche Faktoren können PMS-Symptome verstärken?
Stress, ungesunde Ernährung, Rauchen und übermäßiger Alkohol- oder Koffeinkonsum können PMS-Beschwerden intensivieren. Auch genetische Veranlagung und Übergewicht gelten als Risikofaktoren für stärkere Symptome.
Q3. Wie unterscheidet sich PMDS von PMS?
PMDS ist eine schwerere Form des PMS. Bei PMDS stehen ausgeprägte psychische Symptome im Vordergrund, die den Alltag erheblich beeinträchtigen. Etwa 3-8% der Frauen im gebärfähigen Alter sind davon betroffen, während PMS häufiger auftritt.
Q4. Welche natürlichen Behandlungsmöglichkeiten gibt es für PMS?
Regelmäßige körperliche Aktivität, Stressabbau durch Entspannungstechniken wie Yoga oder Meditation, ausreichend Schlaf und eine ausgewogene Ernährung können PMS-Symptome lindern. Auch pflanzliche Präparate wie Mönchspfeffer und bestimmte Nahrungsergänzungsmittel können hilfreich sein.
Q5. Wann sollte man bei PMS-Beschwerden einen Arzt aufsuchen?Ein Arztbesuch ist ratsam, wenn PMS-Symptome den Alltag erheblich beeinträchtigen oder der Verdacht auf PMDS mit starken psychischen Beschwerden besteht. Auch bei ungewöhnlichen Symptomen wie starken Blutungen außerhalb der Periode oder anhaltenden Unterleibsschmerzen sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.