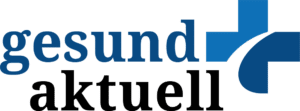Vibrionen Infektionen treten verstärkt auf, wenn die Wassertemperaturen in der Nord- und Ostsee über 20 Grad Celsius steigen. Diese stäbchenförmigen Bakterien vermehren sich besonders stark in warmen Sommermonaten und können beim Menschen schwere Wundinfektionen auslösen. Obwohl sie weltweit vorkommen und sowohl in Salz- als auch in Süßwasser existieren können, sind Infektionen in Deutschland vergleichsweise selten.
Was ist eine Vibrionen Infektion genau und wie verläuft sie? Bis Mitte Juli 2025 wurden mindestens drei Infektionen gemeldet, die wahrscheinlich auf eine Ansteckung in Deutschland zurückgehen, während im vergangenen Jahr insgesamt 42 Fälle erfasst wurden. Besonders gefährdet sind ältere und abwehrgeschwächte Menschen mit chronischen Vorerkrankungen wie Diabetes mellitus oder Tumorerkrankungen. Die Übertragung erfolgt häufig durch kleine Hautverletzungen beim Baden in betroffenen Gewässern, und in schweren Fällen kann es zu einer Sepsis kommen, die zu über 50 Prozent tödlich endet. In Mecklenburg-Vorpommern sind allein in diesem Jahr zwei Menschen im Zusammenhang mit einer Vibrionen-Infektion gestorben, bei insgesamt fünf gemeldeten Infektionen.
Was sind Vibrionen und wie verbreiten sie sich?
Die Gattung Vibrio umfasst über hundert verschiedene Bakterienarten, die weltweit in Gewässern vorkommen. Diese gramnegativen, stäbchenförmigen Bakterien sind mäßig bis stark salzbedürftig (halophil) und bevorzugen besondere Umweltbedingungen.
Definition: Was ist eine Vibrionen-Infektion?
Eine Vibrionen-Infektion wird durch Bakterien der Gattung Vibrio verursacht, die sich im Wasser aufhalten. Zu den humanpathogenen Arten zählen neben dem bekannten Choleraerreger Vibrio cholerae auch Vibrio parahaemolyticus und Vibrio vulnificus. Diese Erreger können auf zwei Wegen in den menschlichen Körper gelangen: durch den Verzehr kontaminierter Meeresfrüchte oder durch Kontakt von offenen Wunden mit erregerhaltigem Wasser. Insbesondere Vibrio vulnificus kann schwere Wundinfektionen verursachen, die unbehandelt zu einer Sepsis führen können. In Japan werden immer wieder Fälle verzeichnet, bei denen die Ansteckung über rohen Fisch oder Meeresfrüchte vermutet wird.
Vorkommen in Nord- und Ostsee
Vibrionen sind Teil der natürlichen Bakterienflora in salzhaltigen Gewässern und leben bevorzugt im Meeresboden. Sie kommen in Flussmündungen, Buchten, Bodden, Brackwasser und teilweise auch in leicht salzhaltigen Binnengewässern vor. Besonders die Ostsee bietet mit ihrem niedrigen Salzgehalt von durchschnittlich 0,8 Prozent ideale Bedingungen für diese Bakterien. Der besonders krankmachende Erreger Vibrio vulnificus wird in der Ostsee häufiger nachgewiesen als in der Nordsee. Die wenigen Infektionen an der Nordseeküste erfolgen hauptsächlich im Bereich von Flussmündungen, wo der Salzgehalt durch Süßwasserzufluss etwas geringer ist.
Warum warme Sommer das Risiko erhöhen
Vibrionen vermehren sich stark bei Wassertemperaturen über 20 Grad Celsius und einem Salzgehalt von 0,5 bis 2,5 Prozent. In warmen Sommern werden daher diese Bedingungen auch an Teilen der deutschen Küsten erreicht. Besonders gefährlich sind flache, sich schnell erwärmende Küstenbereiche, während an tieferen Strandabschnitten mit stärkerer Durchmischung des Wassers die Gefahr geringer ist.Der fortschreitende Klimawandel begünstigt das Auftreten von Vibrionen auch an deutschen Küsten. Durch die Erwärmung der Meere und längere Wärmeperioden verbessern sich die Lebensbedingungen für die Bakterien. Das Robert Koch-Institut erwartet daher eine Zunahme von Infektionen durch Nicht-Cholera-Vibrionen vor allem in den Küstengewässern der Ostsee. Selbst wenn die Wassertemperaturen wieder unter 20 Grad sinken, kann die Bakteriendichte im betroffenen Gewässer noch über Wochen erhöht bleiben.
Wie erfolgt die Ansteckung und wer ist gefährdet?
Die Übertragungswege von Vibrionen sind vielfältig und können selbst bei geringen Erregerzahlen zu schweren Erkrankungen führen. Obwohl die Infektionsgefahr insgesamt gering ist, sollten bestimmte Personengruppen besondere Vorsicht walten lassen.
Übertragung durch Wasser und Lebensmittel
Vibrionen gelangen hauptsächlich auf zwei Wegen in den menschlichen Körper. Zum einen erfolgt die Ansteckung durch direkten Kontakt von Hautverletzungen mit erregerhaltigem Wasser beim Baden, Wasserwaten oder anderen Aktivitäten in betroffenen Gewässern. Besonders in seichtem, flachem Wasser, das sich schnell erwärmt, ist die Infektionsgefahr deutlich größer als an tieferen Strandabschnitten mit Strömung. Zum anderen können Vibrionen durch den Verzehr von rohen oder unzureichend gegarten Meeresfrüchten wie Austern, Muscheln, Krabben und Fisch übertragen werden. Diese lebensmittelassoziierte Übertragungsform ist allerdings eher in wärmeren Regionen verbreitet. Die notwendige Infektionsdosis bei kontaminiertem Wasser mit V. cholerae liegt bei 10⁸ bis 10¹¹ KbE/ml, während sie bei Lebensmitteln mit V. parahaemolyticus bei etwa 10⁵ bis 10⁷ KbE/g liegt.
Risikogruppen: Wer besonders aufpassen sollte
Zu den besonders gefährdeten Personengruppen zählen:
- Ältere Menschen
- Immungeschwächte Personen
- Menschen mit chronischen Vorerkrankungen wie Diabetes mellitus, Lebererkrankungen (z.B. Leberzirrhose) oder Krebserkrankungen unter Chemotherapie
- Personen mit schweren Herzerkrankungen
- Menschen, die immunsupprimierende Medikamente einnehmen
Bei diesen Risikogruppen kann bereits eine geringe Bakterienzahl ausreichen, um eine Infektion auszulösen. Während junge, gesunde Erwachsene bei einer Infektion in der Regel nicht schwer erkranken, kann es bei Menschen aus den Risikogruppen zu dramatischen Krankheitsverläufen kommen. Unter den in Europa bekannten Fällen sind daher nur selten junge gesunde Erwachsene zu finden.
Warum kleine Wunden gefährlich sein können
Selbst kleinste, nicht wahrnehmbare Hautverletzungen können als Eintrittspforte für Vibrionen dienen. Hierzu zählen aufgekratzte Mückenstiche, kleine Schürf- oder Schnittwunden oder frisch gestochene Tätowierungen. Außerdem besteht die Gefahr, sich beim Baden oder Waten erst Verletzungen zuzuziehen, etwa durch Treten auf spitze Steine oder scharfe Muscheln.Bei prädisponierten Personen kann schon eine geringe Bakterienzahl ausreichen, um eine Wundinfektion zu verursachen. Nach dem Eindringen können sich die Bakterien schnell ausbreiten und zu tiefgreifenden Nekrosen und Hautulzerationen führen. Besonders gefährlich ist der Erreger Vibrio vulnificus, der innerhalb kürzester Zeit zu schweren Gewebezerstörungen führen kann.
Symptome und Verlauf einer Vibrionen-Infektion
Je nach Eintrittspforte der Vibrionen in den Körper zeigen sich unterschiedliche Krankheitsbilder. Die Symptome können von leichten Beschwerden bis hin zu lebensbedrohlichen Zuständen reichen.
Typische Symptome: Haut, Magen-Darm, Fieber
Bei Wundinfektionen steht zunächst ein lokaler Schmerz im Vordergrund, der angesichts der oft kleinen Wunde überproportional stark erscheint. Die betroffenen Hautstellen röten sich, schwellen an und überwärmen sich. Häufig kommt es zu Blasenbildung auf der Haut sowie Fieber und Schüttelfrost.
Gelangen Vibrionen über den Verdauungstrakt in den Körper, treten vorwiegend Magen-Darm-Beschwerden auf:
- Krampfartige Bauchschmerzen
- Wässriger Durchfall
- Übelkeit und Erbrechen
Bei Ohrentzündungen durch Vibrionen, die besonders bei Kindern vorkommen, zeigen sich Ohrenschmerzen, Fieber und Ausfluss aus dem Ohr.
Verlauf: Von Rötung bis Sepsis
Oberflächliche Wundinfektionen können sich ohne adäquate Behandlung schnell ausbreiten und zu tiefgreifenden Nekrosen führen. Besonders gefährlich sind Infektionen mit Vibrio vulnificus, die zu schwerwiegender Gewebezerstörung – einer nekrotisierenden Fasziitis – führen können.
Bei Risikopatienten kann die Infektion innerhalb kurzer Zeit zu einer Sepsis (Blutvergiftung) fortschreiten. Diese äußert sich durch Fieber, Schüttelfrost, Übelkeit und eine Verschlechterung des Allgemeinzustands. Unbehandelt droht ein Mehrfachorganversagen oder ein septischer Kreislaufschock mit tödlichem Ausgang. Die Sterblichkeit bei schweren Verläufen beträgt bis zu 20 Prozent, bei Sepsisfällen sogar bis zu 50 Prozent.
Wie schnell treten erste Anzeichen auf?
Die Inkubationszeit bei Vibrionen-Infektionen ist bemerkenswert kurz. Je nach Erregertyp zeigen sich erste Symptome bereits zwischen 4 und 96 Stunden nach der Ansteckung. Bei Vibrio parahaemolyticus treten Symptome normalerweise innerhalb von 12 bis 24 Stunden auf, bei Vibrio vulnificus innerhalb von 12 bis 72 Stunden.Daher erkranken betroffene Personen oft noch in der Nähe des Expositionsortes. Bei Menschen mit Immunschwäche oder chronischen Erkrankungen kann der Verlauf dramatisch sein – schon kurze Zeit nach der Ansteckung droht eine Blutvergiftung mit Multiorganversagen.
Behandlung und Schutzmaßnahmen bei Vibrationen-Infektionen
Eine frühzeitige Behandlung von Vibrionen-Infektionen ist entscheidend, da der Krankheitsverlauf rasch fortschreiten kann. Medizinische Maßnahmen und vorbeugende Strategien können das Infektionsrisiko erheblich senken.
Antibiotika und chirurgische Eingriffe
Die Behandlung von Vibrionen-Infektionen besteht hauptsächlich aus einer schnellen Antibiotikagabe. Bei schwerem Verlauf erfolgt diese intravenös, wobei häufig Cephalosporine der 3. Generation, Gyrasehemmer oder Tetracycline zum Einsatz kommen. Eine aktuelle Leitlinie empfiehlt bei Verletzungen mit Salzwasserexposition eine Kombination aus Doxycyclin und Ceftriaxon.
Bei fortgeschrittenen Wundinfektionen ist zusätzlich eine chirurgische Behandlung erforderlich. In besonders schweren Fällen, wenn sich die Bakterien in schlecht durchbluteten Körperregionen eingenistet haben, kann eine Amputation der betroffenen Gliedmaßen notwendig werden, um eine Ausbreitung auf lebenswichtige Organe zu verhindern.
Was tun bei Verdacht auf Infektion?
Bei Verdacht auf eine Vibrionen-Infektion sollte unverzüglich ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Besonders wichtig ist dabei der Hinweis, dass Kontakt mit Meerwasser bestand. Der behandelnde Arzt sollte vor Beginn der Antibiotikatherapie möglichst Wundabstriche entnehmen, um den Erreger identifizieren zu können. Allerdings darf die Therapie bei dringendem Verdacht nicht verzögert werden.
Wie kann man sich beim Baden schützen?
Menschen mit offenen oder schlecht heilenden Wunden sollten keinen Kontakt mit warmem Meerwasser haben. Dies gilt besonders für Personen mit chronischen Vorerkrankungen oder geschwächtem Immunsystem. Auch frische Operationswunden, Piercings oder Tätowierungen sollten nicht mit warmem Meerwasser in Berührung kommen. Alternativ können kleinere Wunden mit wasserdichtem Pflaster abgedeckt werden.
Gibt es eine Meldepflicht?
Seit März 2020 besteht in Deutschland eine namentliche Meldepflicht für Infektionen mit humanpathogenen Vibrio-Arten. Labore müssen Nachweise von Nicht-Cholera-Vibrionen gemäß § 7 Abs. 1 IfSG melden, sofern der Nachweis auf eine akute Infektion hinweist. Bei reinen Ohrinfektionen gilt dies nur für Vibrio cholerae. Im Jahr 2024 wurden dem Robert Koch-Institut 42 Fälle gemeldet, die wahrscheinlich auf Ansteckungen in Deutschland zurückgingen.
Was tun bei Reisen in Risikogebiete?In Risikogebieten sollte auf rohe Meeresfrüchte verzichtet und diese gründlich gekocht werden. Für Reisende in Cholera-Gebieten gilt: Nur abgekochtes Wasser oder Mineralwasser aus verschlossenen Flaschen trinken und nicht zum Zähneputzen Leitungswasser verwenden. Außerdem empfiehlt es sich, auf Eiswürfel in Getränken zu verzichten und öffentliche Schwimmbäder sowie das Baden in Lagunen zu meiden.
Fazit
Angesichts der steigenden Wassertemperaturen durch den Klimawandel werden Vibrionen-Infektionen an deutschen Küsten wahrscheinlich häufiger auftreten. Obwohl das allgemeine Risiko einer Ansteckung vergleichsweise gering bleibt, sollten besonders gefährdete Personengruppen entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Vor allem Menschen mit chronischen Erkrankungen, einem geschwächten Immunsystem oder offenen Wunden müssen bei Wassertemperaturen über 20 Grad Celsius besonders achtsam sein.
Die schnelle Ausbreitung dieser Bakterien und ihre potenziell schwerwiegenden Folgen machen deutliche Vorsichtsmaßnahmen notwendig. Tatsächlich kann bei Risikopatienten schon eine geringe Bakterienmenge ausreichen, um schwere Infektionen auszulösen. Daher gilt: Wer offene Wunden hat, sollte warmes Meerwasser grundsätzlich meiden oder zumindest wasserdichte Pflaster verwenden.
Wer nach dem Baden an Nord- oder Ostsee ungewöhnlich starke Schmerzen, Rötungen oder Schwellungen bemerkt, sollte unverzüglich ärztliche Hilfe suchen und dabei unbedingt auf den Kontakt mit Meerwasser hinweisen. Je früher eine Behandlung mit Antibiotika eingeleitet wird, desto besser sind die Heilungschancen.Dennoch besteht kein Grund zur übermäßigen Sorge für gesunde Menschen ohne Risikofaktoren. Die meisten Badegäste können die deutschen Küstengewässer weiterhin unbesorgt genießen. Allerdings empfiehlt es sich, über die potenziellen Gefahren informiert zu sein und bei entsprechenden Symptomen rasch zu handeln. Schließlich kann ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Thema dazu beitragen, dass schwerwiegende Infektionen vermieden werden und der Urlaub am Meer ungetrübt bleibt.