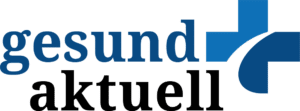Dass Zigarettenrauch krank macht, ist allgemein bekannt. Aber wie schaut es durch das Gesundheitsrisiko durch Toner und Drucker aus? Nur die wenigsten kennen die Gefahren. Dabei sind die gesundheitlichen Auswirkungen von Tonerstaub alarmierend. „Krank durch Toner“-Symptome treten bei Büroarbeitern zunehmend häufiger auf. Schätzungen zufolge sind in Deutschland jährlich tausende Beschäftigte von gesundheitlichen Beschwerden durch Tonerpartikel betroffen.
Dabei zeigen sich die Symptome oft schleichend und werden anfangs häufig unterschätzt oder falsch eingeordnet. Von leichten Atemwegsbeschwerden bis hin zu chronischen Erkrankungen – die Bandbreite möglicher gesundheitlicher Folgen ist beträchtlich.
Frühe Warnsignale der Toner-Erkrankung
Seit den 1990er-Jahren untersuchen Wissenschaftler die Zusammenhänge zwischen Tonerexpositionen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Die Forschungsergebnisse zeigen eindeutige Muster früher Warnsignale, die auf eine mögliche Toner-Erkrankung hinweisen können.
Erste Anzeichen einer Überempfindlichkeit
Untersuchungen belegen, dass Personen mit überempfindlichen Schleimhäuten besonders anfällig für Reaktionen auf Tonerpartikel sind. In Einzelfällen wurden positive Ergebnisse bei Provokationstests festgestellt . Darüber hinaus zeigten Lungenfunktionstests bei sieben von elf untersuchten Personen eine erhöhte bronchiale Reaktivität.
Häufige Atemwegssymptome im Büroumfeld
Die Exposition gegenüber Tonerstaub führt häufig zunächst zu Reizungen der Rachenschleimhaut sowie Halsschmerzen. Nachfolgend entwickeln Betroffene oftmals:
- Husten und Schnupfen
- Kurzatmigkeit
- Atemnot bei körperlicher Belastung
- Chronische Bronchitis
Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass diese Symptome besonders bei direktem Kontakt mit Laserdruckern und Kopiergeräten auftreten. Außerdem wurden in mehreren Fällen Nebenhöhlenprobleme sowie Rhinopathien dokumentiert.
Augen- und Hautreaktionen als Indikatoren
Neben Atemwegsbeschwerden manifestieren sich frühe Warnsignale auch durch:
Augenbeschwerden:
- Brennende Augen
- Bindehautreizungen
- Allergische Augenreaktionen
Hautreaktionen:
- Juckreiz
- Hautreizungen
- Allergische Hautausschläge
Zeitlicher Verlauf der Symptome
Der Verlauf der Beschwerden folgt dabei einem charakteristischen Muster. Zunächst treten unspezifische Reizreaktionen auf, die sich bei andauernder Exposition verstärken können. Besonders bemerkenswert ist, dass die Symptome häufig während der Arbeitszeit zunehmen und sich an arbeitsfreien Tagen bessern.
Forschungsergebnisse zeigen zudem, dass ultrafeine Tonerpartikel über die Lungenbläschen in den Blutkreislauf gelangen und sich anschließend in verschiedenen Organen ablagern können. Diese Partikel enthalten teilweise gesundheitsgefährdende Substanzen wie:
- Quecksilber
- Organozinnverbindungen
- Styrol
- Verschiedene Schwermetalle
Laboruntersuchungen haben nachgewiesen, dass Tonerstaub von Zellen aufgenommen wird und dabei giftige Wirkungen entfaltet. Dabei wurde beobachtet, dass die Exposition zu einem Anstieg freier Sauerstoffradikale führt, die die Erbsubstanz oder körpereigene Eiweiße schädigen können.
Allerdings zeigen die wissenschaftlichen Studien auch, dass die individuellen Reaktionen stark variieren können. Während einige Personen bereits bei geringer Exposition Symptome entwickeln, bleiben andere zunächst beschwerdefrei. Dennoch sollten erste Anzeichen ernst genommen werden, da sich aus anfänglichen Reizreaktionen durchaus chronische Beschwerden entwickeln können 1.
Fortgeschrittene Symptome und Krankheitsbilder
Langzeitstudien belegen zunehmend schwerwiegende Gesundheitsfolgen durch anhaltende Tonerexposition. Besonders besorgniserregend sind dabei die fortschreitenden Krankheitsbilder, die sich nach jahrelanger Exposition entwickeln können.
Chronische Entzündungen der Atemwege
Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die dauerhafte Belastung mit Tonerpartikeln zu krankhaften Veränderungen der Atemwege führt. Dabei entstehen zunächst:
- Eine chronische Entzündung der Atemwege
- Eine andauernde Verkrampfung der Bronchialmuskulatur
- Eine fortschreitende Verengung der Bronchien
Diese Veränderungen verursachen daraufhin eine dauerhafte Verschlechterung der Lungenfunktion. Besonders alarmierend ist, dass diese Entwicklung unbehandelt schnell fortschreitet. Außerdem zeigen Studien, dass bei 90 Prozent der Betroffenen Atemwegserkrankungen auftreten, während 70 Prozent unter Atemwegsallergien leiden.
Nebenhöhlenprobleme und ihre Manifestation
Die fortgeschrittenen Symptome manifestieren sich allerdings nicht ausschließlich in den unteren Atemwegen. Tatsächlich entwickeln viele Betroffene zusätzlich chronische Nebenhöhlenprobleme. Eine Pilotstudie der Universität Gießen untersuchte die Auswirkungen auf Personen an Büroarbeitsplätzen. Dabei zeigte sich, dass die Beschwerden verschiedenste Ursachen haben können und oft mit einer systemischen Entzündungsreaktion einhergehen.
Darüber hinaus wurde nachgewiesen, dass die ultrafeinen Stäube sich aufgrund ihrer physikalisch-chemischen Eigenschaften, insbesondere der elektrostatisch aufgeladenen metallischen Teilchen, kaum aus den Räumen herauslüften lassen. Folglich reichern sich die Partikel über die Zeit in den Räumen an.
Neurologische Beschwerden durch Nanopartikel
Besonders beunruhigend sind die neurologischen Auswirkungen der Nanopartikel. Forschungsergebnisse belegen, dass diese winzigen Teilchen die Blut-Hirn-Schranke überwinden können. Etwa 25 Prozent der Betroffenen entwickeln neurologische Störungen.
Professor Günter Oberdörster von der University of Rochester konnte bildlich nachweisen, dass einatembare ultrafeine Partikel über den Riechkolben die Amygdala und das zentrale Gehirn erreichen. Diese Erkenntnisse sind besonders alarmierend, da die Partikel folgende Eigenschaften aufweisen:
- Sie sind in der Lage, jede Zelle des Körpers zu erreichen
- Sie stören nachweislich das Immunsystem
- Sie wirken inflammatorisch, was langfristig zu Krebs führen kann
Darüber hinaus zeigen Untersuchungen, dass die Emissionen aus komplexen Gemischen bestehen, darunter:
- Flüchtige organische Verbindungen (VOCs)
- Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAKs)
- Endokrine Disruptoren
- Verschiedene Metalle und Chemikalien in ultrafeiner und Nanopartikelgröße
Eine japanische Fallkontrollstudie mit 809 tonerexponierten Arbeitnehmenden und 805 Kontrollpersonen untersuchte die Auswirkungen anhand verschiedener Parameter. Allerdings konnten bezüglich Symptomen, Lungenfunktionstests und biochemischen Parametern keine signifikanten Unterschiede zwischen exponierten und nicht exponierten Personen festgestellt werden.
Dennoch mahnen die Gefahrstoffexperten der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), dass die exakte Zusammensetzung der Partikeltypen weiter erforscht werden muss. Außerdem ist es unerlässlich, Staubgrenzwerte für ultrafeine Partikel an Büroarbeitsplätzen durch die Anwendung eines standardisierten Messverfahrens zur Partikelanzahlkonzentration festzulegen.
Diagnostische Verfahren zum Nachweis
Bei Verdacht auf eine Toner-Erkrankung sind systematische diagnostische Verfahren erforderlich. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung hat spezielle Untersuchungsprotokolle entwickelt, um gesundheitliche Gefährdungen durch Drucker- und Kopierer-Emissionen nachzuweisen.
Ärztliche Untersuchungen bei Verdacht
Zunächst führen Fachärzte eine detaillierte Anamnese durch, wobei der zeitliche Zusammenhang zwischen Tonerexposition und Symptomen dokumentiert wird. Daraufhin erfolgt eine spezifische Routinediagnostik, die folgende Untersuchungen umfasst:
- Pricktests zur Allergiediagnostik
- IgE-Bestimmung im Blut
- Differenzialblutbild
- Lungenfunktionsmessungen
Die Untersuchungsergebnisse werden anschließend mit den Referenzwerten verglichen, um Abweichungen festzustellen.
Spezifische Tests auf Tonerpartikel
Für den direkten Nachweis einer Toner-Erkrankung haben sich mehrere Testverfahren bewährt:
- Provokationstests mit verschiedenen Tonerarten, die durch Differenzialblutbilder und Abstriche kontrolliert werden
- Messung von Stickoxid im Exhalat als sensibler Parameter für Atemwegsentzündungen
- Bestimmung von TNF-alpha-Werten im Blut
Bemerkenswert ist, dass Betroffene auf unterschiedliche Tonerarten verschiedenartig reagieren können. Die Kausalität der Gesundheitsschädigungen durch Toner wurde in etwa 10% der untersuchten Fälle erfolgreich nachgewiesen.
Bildgebende Verfahren bei Atemwegserkrankungen
Zur Diagnose von Atemwegserkrankungen stehen mehrere bildgebende Verfahren zur Verfügung:
Konventionelles Röntgen:
- Standardaufnahmen in posteroanteriorer und seitlicher Einstellung
- Ermöglicht die Beurteilung von Lungenparenchym, Pleura und Mediastinum
Computertomographie (CT):
- Liefert detailliertere Einblicke in intrathorakale Strukturen
- Besonders geeignet zur Erkennung von Infiltraten und Fibrose
- Wird während vollständiger Inspiration durchgeführt
Magnetresonanztomographie (MRT):
- Spielt eine untergeordnete Rolle bei Lungenerkrankungen
- Wird hauptsächlich bei speziellen Fragestellungen eingesetzt
Ausschlussdiagnostik anderer Ursachen
Die Ausschlussdiagnostik ist entscheidend, da ähnliche Symptome auch andere Ursachen haben können. Daher werden systematisch alternative Erkrankungsursachen überprüft:
- Epikutantests zum Ausschluss anderer Allergene
- Untersuchung auf berufsbedingte Konfaktoren
- Prüfung außerberuflicher Expositionen
Darüber hinaus empfiehlt das Bundesinstitut für Risikobewertung spezifische Analysen der Raumluft am Arbeitsplatz. Diese umfassen die Messung von:
- Flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)
- Feinstaubkonzentrationen
- Ozonwerten
Die Diagnose einer Toner-Erkrankung gilt als gesichert, wenn drei Kriterien erfüllt sind:
- Wiederkehrende Entzündungen der Atemwege, Augen oder Haut
- Keine andere erkennbare Ursache
- Eindeutiger Zusammenhang mit der Nutzung tonerhaltiger Bürogeräte
Medizinische Behandlungsansätze bei einer Toner-Erkrankung
Die medizinische Behandlung von Toner-Erkrankungen erfordert einen systematischen Ansatz, der sowohl Sofortmaßnahmen als auch langfristige Therapiestrategien umfasst. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die Beschwerden abnehmen oder sogar vollständig verschwinden, sobald die Aufnahme von Nanopartikeln reduziert wird.
Akutbehandlung bei Toner-Exposition
Bei akuten Beschwerden durch Tonerexposition stehen zunächst folgende Behandlungsschritte im Vordergrund:
Sofortmaßnahmen:
- Unmittelbares Verlassen des belasteten Raums
- Sicherstellung ausreichender Frischluftzufuhr
- Dokumentation der aufgetretenen Symptome
Die Behandlung akuter Symptome erfolgt daraufhin symptombezogen. Insbesondere bei Atemwegsbeschwerden kommen zum Einsatz:
- Inhalation mit hypertoner Kochsalzlösung zur Sekretmobilisation
- Antiobstruktive Medikamente bei Verengung der Atemwege
- Corticosteroide bei akuten Entzündungsschüben
Bei Auftreten von Infektionen ist eine gezielte Antibiotikatherapie erforderlich. Dabei werden je nach Erregernachweis unterschiedliche Wirkstoffe eingesetzt:
- Fluorochinolone wie Levofloxacin oder Ciprofloxacin
- Pseudomonaswirksame Substanzen wie Carbapeneme
- Aminopenicilline mit Inhibitoren
Langzeittherapie chronischer Beschwerden
Für die Langzeitbehandlung chronischer Beschwerden hat sich ein mehrstufiger Therapieansatz bewährt. Zunächst werden arbeitshygienische Maßnahmen ergriffen:
Technische Lösungen:
- Installation moderner, emissionsarmer Geräte
- Einrichtung separater, gut belüfteter Druckerräume
- Optimierung der Raumbelüftung
Medikamentöse Langzeittherapie: Bei anhaltenden Beschwerden erfolgt eine dauerhafte medikamentöse Behandlung. Besonders bewährt haben sich:
- Makrolidantibiotika zur Reduktion von Entzündungsreaktionen
- Inhalative Steroide bei chronischen Atemwegsentzündungen
- Spezifische Immuntherapie bei nachgewiesenen Allergien
Darüber hinaus zeigen Studien, dass bei chronischer Bakterienbesiedlung eine antibiotische Langzeitbehandlung notwendig sein kann. Makrolide haben sich dabei als Antibiotika der ersten Wahl etabliert, da sie:
- Die Häufigkeit von Krankheitsschüben um die Hälfte reduzieren
- Die Zeit bis zum nächsten Krankheitsschub verlängern
- Nebenwirkungsarm sind
Begleitende Therapiemaßnahmen: Ergänzend zur medikamentösen Behandlung werden unterstützende Maßnahmen empfohlen:
- Atemphysiotherapie
- Immunstärkende Maßnahmen
- Regelmäßige Kontrolle der Lungenfunktion
Allerdings zeigen Untersuchungen, dass eine Antibiotikatherapie außerhalb akuter Krankheitsschübe umstritten ist. Weder die Keimmenge noch die Rate der Krankheitsschübe ließ sich durch eine dauerhafte orale Antibiotikagabe signifikant senken.Besonders wichtig ist die regelmäßige Überprüfung des Therapieerfolgs. Eine Langzeittherapie mit Antibiotika oder Makroliden sollte ausschließlich fortgeführt werden, wenn innerhalb von drei Monaten nach Therapiebeginn eine deutliche Besserung der Symptome eintritt.
Dokumentation und rechtliche Schritte
Für Betroffene einer Toner-Erkrankung ist es entscheidend, ihre Symptome sorgfältig zu dokumentieren und rechtliche Schritte einzuleiten. Eine gründliche Aufzeichnung der Beschwerden und die Kenntnis der rechtlichen Möglichkeiten können den Weg zur Anerkennung als Berufskrankheit ebnen.
Führen eines Symptomtagebuchs
Ein Symptomtagebuch stellt ein unverzichtbares Instrument dar, um den Verlauf einer möglichen Toner-Erkrankung zu erfassen. Es dient als Grundlage für ärztliche Diagnosen und eventuelle rechtliche Schritte. Folgende Aspekte sollten täglich dokumentiert werden:
- Art und Intensität der Symptome
- Zeitpunkt und Dauer des Auftretens
- Mögliche Auslöser oder verstärkende Faktoren
- Eingenommene Medikamente und deren Wirkung
Das Führen eines Symptomtagebuchs ermöglicht es, Muster zu erkennen und den Zusammenhang zwischen Tonerexposition und gesundheitlichen Beschwerden nachzuweisen. Zudem unterstützt es Betroffene dabei, ihren Gesundheitszustand besser zu verstehen und achtsamer gegenüber Veränderungen zu werden.
Für eine effektive Dokumentation empfiehlt sich die Verwendung einer strukturierten Vorlage. Diese kann entweder analog oder digital geführt werden und sollte folgende Informationen enthalten:
- Datum und Uhrzeit
- Beschreibung der Symptome
- Schweregrad (z.B. auf einer Skala von 1-10)
- Dauer der Symptome
- Mögliche Auslöser oder Umgebungsfaktoren
- Eingenommene Medikamente oder ergriffene Maßnahmen
- Auswirkungen auf Alltag und Arbeitsfähigkeit
Ein gut geführtes Symptomtagebuch bildet die optimale Vorbereitung für Arzttermine und kann maßgeblich zur Diagnosestellung beitragen.
Meldung als Berufskrankheit
Besteht der Verdacht auf eine Toner-Erkrankung, ist eine Meldung als Berufskrankheit der nächste wichtige Schritt. Dieser Prozess umfasst mehrere Etappen:
- Ärztliche Konsultation: Ein Arzt muss den Verdacht auf eine berufsbedingte Erkrankung bestätigen.
- Meldung an den Unfallversicherungsträger: Der Arzt oder der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Verdacht an die zuständige Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse zu melden.
- Einleitung des Feststellungsverfahrens: Der Unfallversicherungsträger prüft, ob die Voraussetzungen für die Anerkennung einer Berufskrankheit vorliegen.
- Begutachtung: In der Regel werden medizinische Gutachten eingeholt, um den Zusammenhang zwischen der beruflichen Tätigkeit und der Erkrankung zu klären.
- Entscheidung: Der Unfallversicherungsträger entscheidet über die Anerkennung der Berufskrankheit.
Es ist wichtig zu beachten, dass die Anerkennung einer Toner-Erkrankung als Berufskrankheit oft eine Herausforderung darstellt. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat zwar ein Risikobewertungsverfahren für Toner eingeleitet, jedoch gibt es bislang keine spezifische Listung als Berufskrankheit.
Rechtliche Grundlagen für Betroffene
Die rechtlichen Grundlagen für die Anerkennung einer Toner-Erkrankung als Berufskrankheit sind komplex. Folgende Aspekte sind dabei zu berücksichtigen:
- Berufskrankheitenverordnung: Diese listet anerkannte Berufskrankheiten auf. Toner-Erkrankungen sind bisher nicht explizit aufgeführt.
- § 9 Abs. 2 SGB VII: Ermöglicht die Anerkennung einer Erkrankung als Berufskrankheit, wenn neue medizinische Erkenntnisse vorliegen.
- Kausalitätsnachweis: Es muss ein eindeutiger Zusammenhang zwischen der beruflichen Tätigkeit und der Erkrankung nachgewiesen werden.
- Beweislast: Der Betroffene muss den Zusammenhang zwischen Exposition und Erkrankung glaubhaft machen.
- Gutachterliche Stellungnahmen: Fachärztliche Gutachten spielen eine entscheidende Rolle im Anerkennungsverfahren.
Allerdings zeigt die Rechtsprechung, dass die Anerkennung einer Toner-Erkrankung als Berufskrankheit oft schwierig ist. Das Landessozialgericht Hessen hat in einem Urteil vom 21.01.2019 entschieden, dass nach dem epidemiologischen Erkenntnisstand nicht von einer generellen Eignung von Tonerpartikel- oder Laserdruckemissionen, bei Menschen Gesundheitsschäden zu verursachen, ausgegangen werden kann.
Dennoch gibt es Möglichkeiten für Betroffene, ihre Rechte geltend zu machen:
- Widerspruchsverfahren: Bei Ablehnung der Anerkennung kann Widerspruch eingelegt werden.
- Klage vor dem Sozialgericht: Bleibt der Widerspruch erfolglos, besteht die Möglichkeit einer Klage.
- Einzelfallprüfung: Jeder Fall wird individuell geprüft, wobei die spezifischen Umstände berücksichtigt werden.
Erfahrungsberichte erfolgreicher Fälle
Obwohl die Anerkennung einer Toner-Erkrankung als Berufskrankheit eine Herausforderung darstellt, gibt es durchaus erfolgreiche Fälle. Diese Erfahrungsberichte können anderen Betroffenen als Orientierung dienen:
- Fall eines Vervielfältigers: Ein 63-jähriger Mann, der fast vier Jahre in einem Kopierraum tätig war, erreichte in erster Instanz eine teilweise Anerkennung seiner Beschwerden. Allerdings wurde diese Entscheidung in der Berufung revidiert.
- Studie der Interessengemeinschaft Tonergeschädigter (ITG): Die ITG berichtet, dass in etwa 10% der untersuchten Fälle die Kausalität der Gesundheitsschädigungen durch Toner erfolgreich nachgewiesen wurde.
- Einzelfallberichte: In der wissenschaftlichen Literatur finden sich etwa ein Dutzend Einzelfallberichte zu gesundheitlichen Beschwerden nach Toneremissionen. Allerdings waren in den meisten Fällen die Ergebnisse von Epikutantests und Blutuntersuchungen negativ.
- Fall/Kontroll-Studie: Eine Studie mit 540 Afroamerikanern zeigte einen positiven Zusammenhang zwischen Tonerstaubexposition und dem Auftreten von Sarkoidose.
Diese Erfahrungsberichte verdeutlichen, dass eine erfolgreiche Anerkennung zwar möglich, aber oft mit langwierigen Verfahren verbunden ist. Entscheidend für den Erfolg sind:
- Lückenlose Dokumentation der Symptome
- Nachweis der Exposition am Arbeitsplatz
- Ausschluss anderer möglicher Ursachen
- Unterstützung durch Fachärzte und Gutachter
Betroffene sollten sich bewusst sein, dass jeder Fall individuell betrachtet wird. Die Erfolgsaussichten hängen stark von der Qualität der Dokumentation und der Eindeutigkeit des Kausalzusammenhangs ab.Abschließend ist zu betonen, dass die rechtliche Situation bezüglich Toner-Erkrankungen weiterhin im Fluss ist. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Gerichtsurteile können die Anerkennungspraxis in Zukunft beeinflussen. Daher ist es für Betroffene ratsam, sich regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zu informieren und gegebenenfalls rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen.
Das Recht auf saubere Luft ist seit 2022 ein Menschenrecht
Aus diesem Grund beschäftig sich die Internationale Stiftung „nano-Control“ auch schon seit mehr als 18 Jahren mit dem Thema krank durch Toner. Wer Betroffen ist, kann sich gerne dort melden und nach Hilfsangeboten fragen.
Schlussfolgerung
Toner-Erkrankungen stellen eine ernstzunehmende gesundheitliche Gefährdung am Arbeitsplatz dar. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen eindeutig die Zusammenhänge zwischen Tonerexposition und verschiedenen Gesundheitsproblemen – von Atemwegserkrankungen bis hin zu neurologischen Störungen.
Die frühzeitige Erkennung erster Warnsignale spielt eine entscheidende Rolle. Betroffene sollten Symptome wie Atemwegsbeschwerden, Hautreaktionen oder neurologische Probleme ernst nehmen und umgehend dokumentieren. Systematische diagnostische Verfahren ermöglichen dabei eine präzise Abklärung der Beschwerden.
Medizinische Behandlungsansätze umfassen sowohl Akutmaßnahmen als auch langfristige Therapiestrategien. Besonders wichtig erscheint die konsequente Reduktion der Tonerexposition durch technische und organisatorische Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz.
Die rechtliche Anerkennung einer Toner-Erkrankung als Berufskrankheit gestaltet sich zwar oft schwierig, dennoch existieren erfolgreiche Präzedenzfälle. Sorgfältige Dokumentation und fachärztliche Unterstützung erhöhen dabei die Erfolgschancen deutlich.Schließlich zeigt die aktuelle Forschung: Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz muss weiter verbessert werden. Arbeitgeber und Beschäftigte sollten gemeinsam präventive Maßnahmen entwickeln und umsetzen. Nur durch konsequentes Handeln lassen sich die Risiken einer Toner-Erkrankung nachhaltig minimieren.
Referenzen und weiterführende Links
[1] – https://www.haufe.de/arbeitsschutz/arbeitsschutz-office-professional/tonerstaub-risiken-und-schutzmassnahmen-im-buero-3-gesundheitliche-beeintraechtigungen_idesk_PI13633_HI2650510.html
[2] – https://www.dguv.de/medien/ipa/forschung/documents/vbg_toner07.pdf
[3] – https://www.bfr.bund.de/de/publication/gesundheitliche_beschwerden_durch_toner-8644.html
[4] – https://www.nano-control.org/wp-content/uploads/2016/04/KdT-Nanopatholgie.pdf
[5] – https://www.zavamed.com/de/symptomtagebuch.html?srsltid=AfmBOopE_ooYDd7nSJy4CjR4Gvjcp7l6T2czhnnYVtFR1SrjVECztD08
[6] – https://content.boehringer-ingelheim.com/DAM/fce1a6cd-9275-4de6-8ed7-ae2b0102ffb4/geheimcode-copd-patientenratgeber.pdf?v1674691200125
[7] – https://www.stiftungen.org/aktuelles/news-aus-stiftungen/detail/computer-bild-testet-farblaserdrucker-nano-control-sagt-feinstaubmessungen-sind-relevant-laserdrucker-niemals-ins-home-office-12968.html
[8] – https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/chem/wohngifte/gesund-wohnen/drucker/factsheet-gesundheitsgefaehrdung-durch-laserdrucker.pdf.download.pdf/factsheet-gesundheitsgefaehrdung-durch-laserdrucker-kopiergeraete-toner%20Juli2015_D.pdf
[9] – https://www.msdmanuals.com/de/profi/lungenkrankheiten/diagnostische-und-therapeutische-pulmonale-untersuchungsmethoden/bildgebende-verfahren
[10] – https://www.konsumentenschutz.ch/online-ratgeber/laserdrucker-gesundheitsschaedlich/
[11] – https://www.gesundheits-lexikon.com/Lunge/Bronchiektasen/Medikamentoese-Therapie
[12] – https://www.doktus.de/gefahr-durch-tonerstaub/
[13] – https://mobil.bfr.bund.de/cm/343/gesundheitliche_beschwerden_durch_toner.pdf
[14] – https://www.michaelbertling.de/beamtenrecht/dienstunfall/tonerstaub.htm
[15] – https://rsw.beck.de/aktuell/daily/magazin/detail/erkrankungen-durch-tonerstaub-einwirkungen-als-berufskrankheit
[16] – https://www.haufe.de/arbeitsschutz/recht-politik/keine-anerkennung-von-atembeschwerden-durch-tonerstaub_92_486626.html